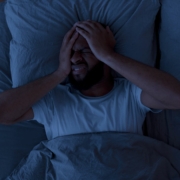General: „Soldaten stehen im Dienst an der Gesellschaft“
Seit dem Krieg in der Ukraine steht die Bundeswehr besonders im Fokus. General Jürgen-Joachim von Sandrart ist Soldat in zehnter Generation und erklärt, wie Soldaten der Gesellschaft dienen und selbst Gefahren auf sich nehmen.
Eigentlich wollte er Land- und Forstwirt werden, um dann, wie sein Großvater nach dem Ersten Weltkrieg, in Argentinien eine Farm aufzubauen. Aber dann kam alles anders. Jürgen-Joachim von Sandrart wurde Soldat und führte damit eine noch ältere Familientradition in der zehnten Generation fort. Er absolvierte die damals übliche Wehrpflicht, verpflichtete sich anschließend für zwei Jahre und schlug die Laufbahn zum Reserveoffizier ein. Als Zeitsoldat studierte er an der Universität der Bundeswehr in Hamburg Wirtschafts- und Organisationswissenschaften. Mit einem Schmunzeln denkt er an diese Zeit zurück: „Ich bin sicherlich kein Vorzeigestudent gewesen. Ich habe das Studium gemacht, weil es ein Auftrag war, eher schlecht als recht. Für mich stand immer im Vordergrund, Soldat zu sein – mit Menschen im Team zu arbeiten, zu gestalten und ein Team zu führen –, nicht Wirtschaftsakademiker.“ Da lag es nahe, dass er nach dem Studium schließlich Berufssoldat wurde. Auch seine zukünftige Frau Harriet fand ein Ja dazu. 1991 heirateten die beiden.
GEFÄHRDETE BEZIEHUNG
Er arbeitete sich hoch vom Leutnant bis zum Oberst. Dazu gehörte auch der häufige Wechsel der Standorte Hamburg – Lüneburg – Strasburg – Rosengarten – Wöhrden bei Stade – und damit verbunden viele Umzüge für die Familie von Sandrart. 2008 entschied sich das Ehepaar für eine Fernbeziehung zugunsten einer kontinuierlichen Schulbildung und einem stabilen Umfeld für die Kinder. Mutter Harriet zog mit den drei Söhnen und der Tochter nach Stade. Vater Jürgen-Joachim kam an den Wochenenden von seinem jeweiligen Standort angereist. Eine große Herausforderung für alle Beteiligten. Sie sind dankbar, dass sie das als Familie und Paar so gut gemeistert haben. Das ist nicht selbstverständlich, denn die Scheidungsrate bei der Bundeswehr liegt deutlich im höheren zweistelligen Bereich.
Herausfordernd waren auch die Auslandseinsätze, an denen Jürgen-Joachim von Sandrart teilgenommen hat. Dreimal war er für jeweils mehrere Monate im Einsatz, dazu zählten Einsätze auf dem Balkan und in Afghanistan. Hier überlebte er 2011 nur knapp einen Anschlag, bei dem elf Menschen getötet und neun weitere schwer verletzt wurden. Bis heute redet er in der Öffentlichkeit „sehr ungern“ über dieses Ereignis. Er befürchtet, dass viele nur eine Abenteuergeschichte hören wollen und darüber vergessen, wie traurig und auch traumatisch alles war. Und wenn er doch etwas erzählt, dann spiegelt seine Mimik und Gestik wider, wie nah ihm das alles geht, auch heute noch, mehr als zwölf Jahre später. „Ich bin dankbar, dort unversehrt herausgekommen zu sein. Wir haben Kameraden verloren, die ich beide auch sehr gut kannte. Ich bin dankbar für eine herausragend gute Ausbildung, die mir erlaubt hat, zu überleben und richtig zu reagieren. Und ich danke dem lieben Gott.“ Den „lieben Gott“ kennt er von Kindesbeinen an. Der christliche Glaube wurde in seinem Elternhaus ganz natürlich gelebt und prägt bis heute seinen Alltag. „Das Ungewisse ist eine wesentliche Herausforderung des soldatischen Lebens. Wenn Sie im Einsatz führen, wissen Sie letztendlich nie zu hundert Prozent, was auf einen zukommt; wir bezeichnen dies als Handeln und Führen ins Ungewisse. Es gibt keine hundertprozentige Gewissheit, wie sich Dinge entwickeln werden, welche Herausforderungen vor einem liegen, welche Entscheidungen man treffen muss für die einem Anvertrauten und für sich selbst. Sie müssen sich in jeder Situation fragen: Was ist jetzt zielführend? Was ist richtig? Was ist auszuschließen? Was ist zweckmäßig?“
GEFÄHRDETES LEBEN
Vielleicht konnte er deshalb nach dem Anschlag in Afghanistan schneller wieder zur Tagesordnung übergehen. „Weitermachen! Wir wissen, dass das zum Soldatenberuf dazugehört“, war und ist seine Devise. Spätestens jetzt wird deutlich, dass „Soldat“ kein Beruf ist wie jeder andere. In kaum einem anderen Beruf legt man einen Eid ab, in dem man gelobt, „… der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe“. In letzter Konsequenz kann das bedeuten, dass „der Beruf auch hinter das irdische Leben führen kann“, so umschreibt es Jürgen-Joachim von Sandrart.
Trotzdem legt er an den Soldatenberuf letztlich die gleiche Messlatte an wie an jeden anderen Beruf. „Jeder soll sich authentisch, aufrecht und mit aller ihm zur Verfügung stehenden Energie seinem Berufsfeld widmen. Als Soldat stellt man sich in den Dienst einer Gesellschaft. Das tun viele Berufsfelder: Pfleger, Lehrer, Blaulichtorganisationen, Politiker, Pastoren und viele mehr. Der Unterschied zum Soldatenberuf liegt in der Tatsache begründet, dass sich der Soldat verpflichtet, notfalls mit seinem höchsten Gut – seinem Leben – für die Gesellschaft einzustehen.“ Diese Sicht findet sich auch im Selbstverständnis der Bundeswehr, das in diesen drei Worten zusammengefasst ist: „Wir.Dienen.Deutschland.“ 2020 hat von Sandrart als Kommandeur der 1. Panzerdivision Oldenburg anhand dieser drei Worte das Alleinstellungsmerkmal des Soldatenberufes und sein persönliches Führungsverständnis als Soldat und Kamerad in einem Kommandeur-Brief entfaltet. 20.000 Soldatinnen und Soldaten, für deren Ausbildung und Führung er als Generalmajor zuständig war, lasen seine Ausführungen. Darin, wie auch in Ansprachen an die jungen Feldwebel und Offiziere, zitiert er die Bibel. Zum Beispiel Worte aus dem Epheserbrief: „Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“ „Für mich war der christliche Glaube immer das hilfreichste Koordinatenkreuz“, erklärt er. Missionieren will er auf keinen Fall. Er ist davon überzeugt, dass man auch in anderen Glaubensrichtungen und Werteverständnissen die gleichen fundamentalen Prinzipien des menschlichen Miteinanders findet wie im Christentum.
GEFÄHRDETER FRIEDEN
2021 nahm Jürgen-Joachim von Sandrart die nächste Karrierestufe. Er übernahm sein jetziges Kommando und wurde zum Generalleutnant ernannt. Als kommandierender General des Multinationalen Korps Nordost in Stettin ist er der höchste taktische militärische Führer für Landoperationen an der NATO Nordostflanke. Der Verantwortungsbereich des Multinationalen Korps Nordost umfasst die Länder Estland, Lettland, Litauen und Polen, die sämtlich eine gemeinsame Landgrenze mit Russland und Belarus teilen. Mit dem Beginn des Ukraine-Krieges im Februar 2022 hat sein Korps, das aus vierundzwanzig Nationen besteht, eine ganz neue Bedeutung bekommen. Jürgen-Joachim von Sandrart trägt damit auch eine große Verantwortung. „Das Risiko, dass sich dieser Krieg ausweitet über das derzeitige Kriegsgeschehen in Russland und der Ukraine hinaus, ist grundsätzlich gegeben. Daraus sollte keine Untergangsstimmung entstehen, sondern daraus muss der Ansporn entstehen: Es ist wert, sich dafür einzusetzen, dass wir es gemeinsam hinbekommen, die Ausweitung des Krieges zu verhindern und gleichzeitig der Ukraine helfen, den Krieg gegen Russland zu gewinnen. Und ich bin auch sicher, dass wir das schaffen! Aber dafür müssen wir noch konsequenter sein. Grundsätzlich bin ich der Überzeugung, dass es keine schnelle Lösung zum Besseren geben wird.“
Bis Ende 2024 steht Generalleutnant Jürgen-Joachim von Sandrart noch dem Multinationalen Korps Nordost vor, das als „Schlüsselelement der Abschreckung und Verteidigung an der Nordostflanke der NATO in Europa“ fungiert, wie auf der Homepage der Bundeswehr zu lesen ist.* Wie es danach für den Generalleutnant weitergeht, ist noch nicht entschieden. Obwohl die Bundeswehr für ihn nur ein Plan B gewesen ist, hat ihn „der Zauber guter Führung und früher Verantwortungsübertragung bis heute aus inniger Überzeugung an den Soldatenberuf gefesselt“. Mit einem zufriedenen Lächeln kommentiert er das so: „Heute bin ich Hobby-Landwirt. Aber im Wesentlichen: Ehemann, Vater und Soldat! Und das sehr gerne. Ich bereue keine Minute meine Entscheidung! Mein unendlicher Dank gilt meiner Frau und den Kindern, die die Last der Wochenendehe, der Einsätze und der vielfältigen dienstlich begründeten Wechselspiele so großmütig und verständnisvoll getragen haben.“
Sabine Langenbach ist Journalistin, Moderatorin und Autorin. Mit einer Mischung aus Feingefühl und Hartnäckigkeit hat sie schon so manchem Interviewpartner vor Mikrofon, Kamera und Publikum Unerwartetes entlocken können. Als „Die Dankbarkeitsbotschafterin“ veröffentlicht sie regelmäßig den Montagsimpuls auf ihrem YouTube-Kanal. sabine-langenbach.de
General Jürgen-Joachim von Sandrart (61), verheiratet, vier erwachsene Kinder. Seit November 2021 ist er Kommandierender General des Multinationalen Korps Nordost in Stettin. Als taktischer Führer ist er verantwortlich für alle Landoperationen an der NATO-Nordostflanke, die an Russland und Belarus grenzen: also Estland, Lettland, Litauen, Polen. Der Korpsstab besteht aus vierundzwanzig Nationen und führt derzeit unter anderem mehrere Divisionen und Brigaden. *bundeswehr.de/de/organisation/heer/organisation/multinationales-korps-nordost